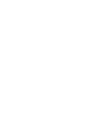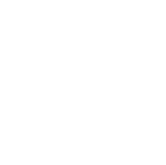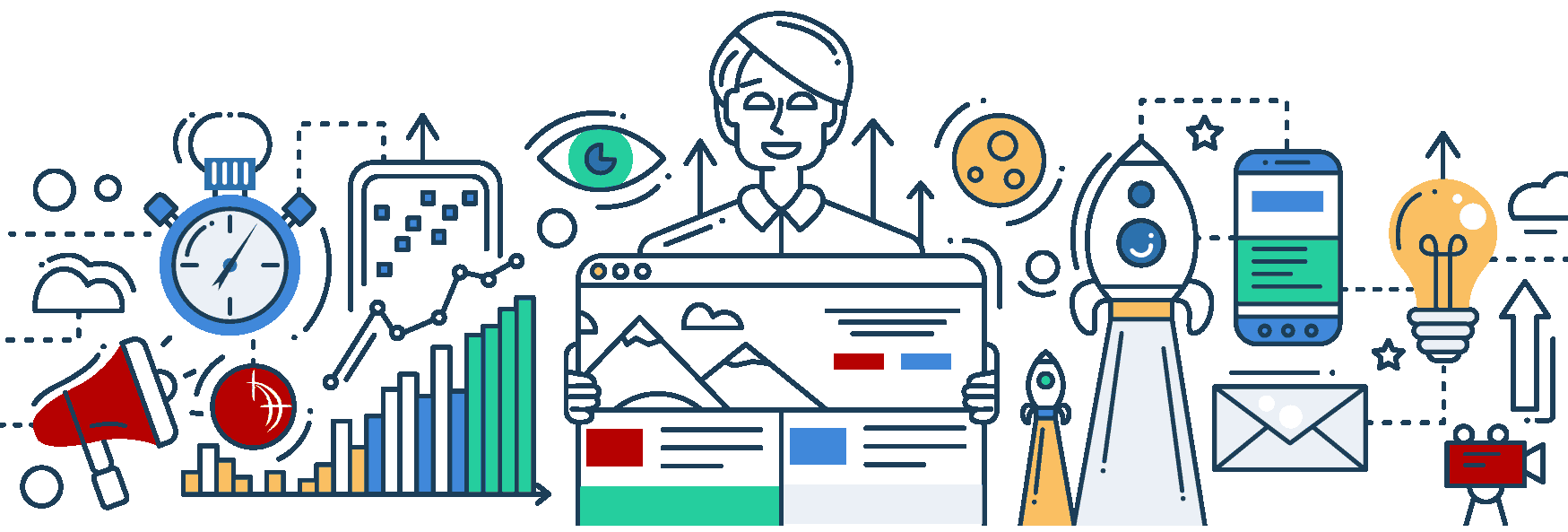Erst hinsitzen und beobachten – dann schaffen
Tobias und Sarah Müller arbeiten seit August 2023 in Toronto, Kanada, und leiten dort das Programm „impact-move“. Außerdem sind sie für die Studierenden der Interkulturellen Theologischen Akademie (ITA) während ihres Auslandssemesters in Toronto zuständig. Zuvor haben sie zwölf Jahre in Malawi gearbeitet. Tobias ist gelernter Elektroinstallateur und hat seine Ausbildung am Theologischen Seminar der Liebenzeller Mission absolviert. Jetzt hat er berufsbegleitend an der Akademie für Weltmission (AWM) in Korntal den Masterstudiengang „Interkulturelle Leitung und Führung“ erfolgreich abgeschlossen.
Tobias, was hat dich bewogen, ein solch anspruchsvolles Studium berufsbegleitend zu absolvieren?
Bei diesem Studium geht es nicht nur darum, einen Masterabschluss zu erlangen, sondern die eigenen Erfahrungen als Missionar kontinuierlich zu reflektieren. Dafür hat man bis zu zehn Jahre Zeit. Ich habe es in acht Jahren geschafft. Jedes Jahr belegt man in der Regel ein bis zwei angebotene Kurse zu verschiedenen Themen, die einen betreffen. Ich habe mich von Anfang an darauf konzentriert, was man jungen Missionaren mit auf den Weg geben kann, bevor sie ausreisen: Was müssen sie in ihren ersten Jahren als Missionare lernen, damit sie effektiver und nachhaltiger arbeiten können?
Und diese Kurse fanden alle in Korntal statt?
Anfangs ja. Aber durch die Corona-Pandemie wurde das Studium umgestellt und alles fand online statt. Das hat mir sehr geholfen. Allerdings hat der Austausch mit den Kollegen vor Ort gefehlt, was ursprünglich ein Hauptanliegen des Studiums war. Daher war es sehr schade, dass dies durch und nach der Corona-Pandemie nicht mehr möglich war.
Was hast du während deines Studiums gelernt?
Ich habe zum Beispiel einen Kurs in interkultureller Kommunikation belegt. Das war sehr spannend. Außerdem ging es um die Persönlichkeit eines Leiters. Ein anderer Kurs beschäftigte sich mit dem Leiten multikultureller Teams. Ich habe auch theologische Kurse belegt, unter anderem über die Theologie der Mission. Ich habe auch an Studieneinheiten teilgenommen, in denen Coaching-Kompetenzen vermittelt wurden.
Wie hilft dir das Studium bei deiner Arbeit?
Zunächst hilft es natürlich ganz persönlich: Man kann sich erst einmal selbst reflektieren, wer man ist und was meine Gaben sind. Außerdem bekommt man viel Wissen und Handwerkszeug für seine Arbeit vermittelt. Man kann auch Erfahrungen reflektieren, die einem so gar nicht bewusst sind. Man bekommt auch ein Verständnis für die Kultur, in der man lebt. Natürlich kann einem dabei ein einheimischer Mitarbeiter helfen. Aber man muss sich bewusst sein, dass ein Einheimischer nie die ganze Kultur repräsentiert. Das ist ein wichtiger Punkt, weil Missionare das oft nicht berücksichtigen. Diese denken oft, dass der beste einheimische Mitarbeiter vor Ort die Kultur des Landes umfassend kennt und deshalb alle Fragen beantworten kann. Dem ist aber nicht so. Und es hilft auch, wenn ich neuen Missionaren Werkzeuge an die Hand geben kann, die ich in diesem Studium gelernt habe.
Was war für dich der größte Aha-Effekt während deines Studiums?
Mir ist bewusst geworden, dass wir in Deutschland eine sogenannte kontextarme Kommunikation pflegen: Bei uns muss man so deutlich wie möglich sagen, was man will. Es ist also die Aufgabe des Sprechers, so klar wie möglich zu kommunizieren und die Botschaft zu vermitteln. In vielen anderen Kulturen hingegen, vor allem in Schamkulturen, muss der Zuhörer herausfinden, was der Sprecher mitteilen will. Darüber hinaus gibt es Kulturen, in denen man Menschen auf keinen Fall vor den Kopf stoßen möchte und daher negatives Feedback eher vermeidet oder verpackt. Das kann schwerwiegende Folgen haben. Wenn etwa ein nordamerikanischer Chef zu einem sagt: „Heute warst du ein bisschen zu spät“, dann ist das die letzte Warnung. Aber Deutsche hören das vielleicht so, als wäre das gar nicht so schlimm. Und dann wundern sie sich, wenn ihnen im nächsten Monat gekündigt wird. In anderen Kulturen wird also oft nicht so direkt kommuniziert wie in Deutschland. Die Zuhörer müssen eher herausfinden, was man ihnen sagen will. In Afrika habe ich auch festgestellt, dass man diesen Kommunikationsstil übernimmt: Man ist weniger direkt. Die Kultur, in der man lebt, wird auch zur eigenen.
Was denkst du, muss ein Missionar ganz schnell lernen zum Berufsstart?
Auf Englisch würde ich sagen: „Observe before serving“, also dass wir lernen, zuerst zu beobachten, bevor wir anfangen, tätig zu werden. Wir Liebenzeller Missionare sind dafür bekannt, dass wir regelrechte Schaffer sind. Das ist verständlich, denn wenn man in die Mission geht, hat man oft wenig Zeit und will schnell etwas aufbauen und entwickeln. Aber aus meiner Sicht ist es gerade in den ersten zwei Jahren wichtiger, erst einmal zu lernen, also sich buchstäblich hinzusetzen und zu beobachten.
Wir haben oft verlernt zu schauen, wie sich Menschen verhalten und warum sie sich so verhalten. Ich selbst habe in meiner Zeit in Malawi erlebt, dass junge Missionare gekommen sind und mir dann Fragen gestellt haben, die mir gar nicht mehr bewusst waren und von denen ich nach sechs oder acht Jahren Einsatz immer noch lerne, weil ich gemerkt habe, dass ich betriebsblind geworden bin. Ich habe das gar nicht mehr so wahrgenommen, weil sich blinde Flecken entwickelt haben.
Man muss auch sehen, dass sich Mission verändert hat. Wir sprechen zu Recht von Partnerschaft und Partnerschaft findet immer auf Augenhöhe statt. Deshalb ist es wichtig, diese Fähigkeiten zu entwickeln.
Wir wollen zudem die Einheimischen herausfordern und ihnen helfen, ihre eigenen Strategien und ihre eigenen Projekte zu entwickeln; in ihrem Tempo, mit ihren Ressourcen und nach ihren Ideen.
Es geht nicht darum, Projekte zu entwickeln, von denen wir glauben, dass sie ihre größten Probleme lösen. Denn unsere Einschätzungen sind oft falsch, die Menschen vor Ort wissen das oft besser. Schließlich ist es ihr Land und ihr Weg mit ihren Mitmenschen. Wir sind nur da, um die Menschen eine gewisse Wegstrecke zu begleiten. Gerade deshalb müssen wir in der Lage sein, Vertrauen aufzubauen. Das ist eine wichtige Grundlage. Wenn man Mission als Partnerschaft versteht, muss man sich überlegen, wie man Menschen in der jeweiligen Kultur überzeugen kann. Wie gibt man in dieser Kultur das richtige Feedback? Man benötigt einfach mehr Zeit, um das herauszufinden, bevor man losgeht.
Muss sich also jeder Missionar ständig weiterbilden?
Ich würde sagen, nicht fortbilden, sondern seine Arbeit kontinuierlich reflektieren. Wenn man das nicht tut und sich nicht mit anderen austauscht, schwimmt man nur in seinem eigenen Teich. Das gilt für alle Berufe, ob man nun als Pastor, Sozialpädagoge oder Banker in Deutschland arbeitet – es ist immer gut, über den Tellerrand zu schauen, und das bietet das Studium.